Zusammenfassung
- Definition:Entzündliche, raumfordernde Leberläsion durch infektiöse Erreger. Zu unterscheiden sind der pyogene Abszess und der Amöbenabszess.
- Häufigkeit:Inzidenz ca. 2–3 pro 100.000 Einw./Jahr.
- Symptome:Abgeschlagenheit, rechtsseitiger Oberbauchschmerz,
Schüttelfrost, Übelkeit/Erbrechen. - Befunde:Fieber, Hepatomegalie, Leber schmerzhaft palpabel.
- Diagnostik:Diagnosestellung durch Bildgebung (Sonografie, CT). Punktion zum Keimnachweis bei pyogenem Abszess, Serologie auf E. histolytica bei Amöbenabszess.
- Therapie:Antimikrobielle Therapie. Drainage bei pyogenem Abszess.
Allgemeine Informationen
Definition
- Entzündliche, raumfordernde Leberläsion durch infektiöse Erreger1
Häufigkeit
- Inzidenz
- ca. 2–3 pro 100.000/Jahr
- Geschlecht
- Männer zu Frauen ca. 3 : 1
- Regionale Verteilung
- In westlichen Ländern ist der pyogene Leberabszess dominierend, in tropischen und subtropischen Regionen der Amöbenabszess.2
- In Industrieländern kein endemisches Vorkommen von Entamoeba histolytica mehr, betroffen sind vorwiegend Migrant*innen und Individualreisende.
Ätiologie und Pathogenese
Ätiologie
- Ätiologisch können unterschieden werden:3
- pyogene Abszesse (oft bakterielle Mischinfektionen): ca. 80 %
- Amöbenabszess: ca. 10 %
- Pilzabszess (meist Candida): < 10 %.
Pathogenese – pyogene Leberabszesse
- Genese
- biliär (am häufigsten), vor allem bei:
- benignen oder malignen Gallenwegsstenosen
- Lebertumoren.
- hämatogen infolge von portalvenösen Bakteriämien bei:
- Appendizitis/perityphlitischer Abszess
- Divertikulitis
- chronisch-entzündlicher Darmerkrankung.
- per continuitatem
- arterielle septische Embolien
- posttraumatisch
- biliär (am häufigsten), vor allem bei:
- Erregerspektrum
- in der Regel polymikrobielle Infektion
- Häufig isolierte Keime sind:
- Enterokokken
- Enterobakterien (E. coli, Klebsiellen)
- Anaerobier.
Pathogenese – Amöbenabszesse
- Fäkal-orale Infektion durch Aufnahme von Zysten (kontaminierte Nahrung bzw. verunreinigte Getränke)
- Im Rahmen einer Amöbenkolitis können Trophozoiten über die Pfortader in die Leber gelangen.
- Ein Leberabszess ist die häufigste extra-intestinale Manifestation der Amöbenruhr.
Prädisponierende Faktoren
- Risikofaktoren für die Entwicklung eines pyogenen Leberabszesses sind:4
- Diabetes mellitus
- Leberzirrhose
- Immunsuppression
- Einnahme von Protonenpumpen-Inhibitoren
- höheres Alter
- männliches Geschlecht.
ICD-10
- K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten
- K75.0 Leberabszess
Diagnostik
Diagnostische Kriterien
- Verdacht auf die Erkrankung durch Anamnese, klinisches Bild und Labor
- Diagnosesicherung durch Bildgebung (Ultraschall, CT)
- Keimnachweis durch Punktion (nicht beim Amöbenabszess)
Differenzialdiagnosen
Anamnese
- Symptome
- Abgeschlagenheit
- rechtsseitiger Oberbauchschmerz (evtl. Ausstrahlung in Schulter/Rücken)
- Schüttelfrost
- Übelkeit/Erbrechen
- Vorerkrankungen
- Leberzirrhose, Lebertumor
- Cholelithiasis, Operationen/Interventionen an den Gallenwegen
- chronisch-entzündliche Darmerkrankung
- Divertikulitis
- Diabetes mellitus
- Medikation
- Immunsuppressiva
- Protonenpumpen-Inhibitoren
- Reiseanamnese (Amöbenabszess)
- Aufenthalt in tropischen Regionen (auch vor vielen Jahren)
- oft anamnestisch keine Hinweise auf (blutige) Diarrhöen
Klinische Untersuchung
- Schlechter Allgemeinzustand
- Fieber (intermittierend oder kontinuierlich)
- Hepatomegalie, Leber schmerzhaft palpabel
Ergänzende Untersuchungen in der hausärztlichen Praxis
Labor
- Blutbild
- Entzündungsparameter (BSG, CRP)
- Leberwerte, Cholestaseparameter, Lebersyntheseparameter (Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT, AP, Albumin, INR)
- Evtl. Blutkulturen
- Bei V. a. Amöbenabszess
- Serologie auf Entamoeba histolytica (Sensitivität nahezu 100 %)
- in der Standard-Stuhlmikroskopie häufig keine Amöben
Sonografie
- Typischerweise echoarme Darstellung des Abszesses
Rö-Thorax
- Evtl. angehobenes Zwerchfell, Pleuraerguss
Diagnostik bei Spezialist*innen
Sonografie mit Kontrastmittel
- Echoarmes Zentrum mit Kontrastanreicherung des Abszessrandes
CT mit Kontrastmittel
- Hypodenses Zentrum mit Kontrastanreicherung des Abszessrandes3
Abszesspunktion
- Beim pyogenen Abszess zum Keimnachweis
- Beim Amöbenabszess im Allgemeinen nicht indiziert
Indikationen zur Überweisung/Klinikeinweisung
- Überweisung und ggf. stationäre Einweisung bei Verdacht auf die Erkrankung
Therapie
Therapieziele
- Infektion sanieren.
- Komplikationen vermeiden bzw. behandeln.
Allgemeines zur Therapie
- Basis ist die antimikrobielle Behandlung.
- Beim pyogenen Abszess je nach Größe und Lokalisation ergänzend perkutane/endoskopische Drainage oder Operation
Medikamentöse Therapie
Pyogener Abszess
- Mögliche empirische Regime
- Breitspektrumpenicilline plus Betalaktamase-Inhibitor (z. B. Piperacillin-Tazobactam)
- Cephalosporine der 3. Generation plus Metronidazol
- Ciprofloxacin plus Metronidazol
- Carbapeneme
- I. v. Therapie über ca. 14 Tage, anschließend orale Therapie über weitere 2–4 Wochen
Amöbenabszess
- Metronidazol 3 x 10 mg/kg KG/d (max. 3 x 800 mg/d) i. v. oder oral über 10 Tage
- Eradikation einer evtl. noch bestehenden Darmlumeninfektion mit Paromomycin 25–30 mg/kg tgl. oral über 10 Tage
- Wegen Rupturgefahr unter Therapie strenge Bettruhe in den ersten Tagen
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Komplikationen
Pyogener Abszess
Amöbenabszess
- Typische Komplikation des Amöbenabszesses ist die Ruptur gefolgt von:
- meist Ausbreitung ins Peritoneum
- seltener Ausbreitung in Pleura oder Perikard.
Prognose
Pyogener Abszess
- Ein unbehandelter pyogener Abszess verläuft in der Regel tödlich.3
- Ansonsten Mortalität ca. 10 %
- Mittlerer Zeitraum bis zur vollständigen Resolution in der Bildgebung ca. 10 Wochen
- Rezidiv bei bis zu 15 % der Patient*innen, insbesondere bei:
- multiplen oder bilobulären Abszessen
- Abszessen durch multiresistente Erreger
- vorausgegangenen Cholangitiden.
Amöbenabszess
- Gute Prognose, Letalität < 1 %
- Beim Amöbenabszess unter Therapie rasche klinische und subjektive Besserung mit Fieberabfall und Schmerzabnahme bereits in den ersten 12 Stunden
- Rückbildung der Abszesshöhle nach erfolgreicher Therapie allmählich über Monate
Patienteninformationen
Patienteninformation in Deximed
Illustrationen
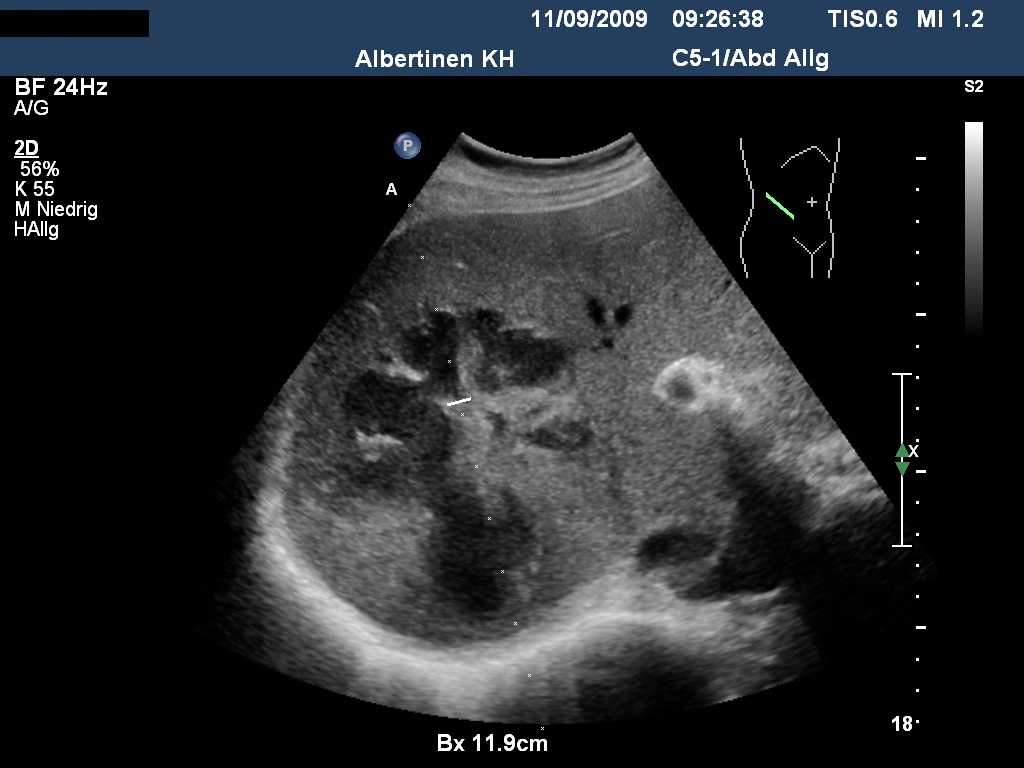
Sonografie: großer pyogener Leberabszess vor Drainageanlage (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)
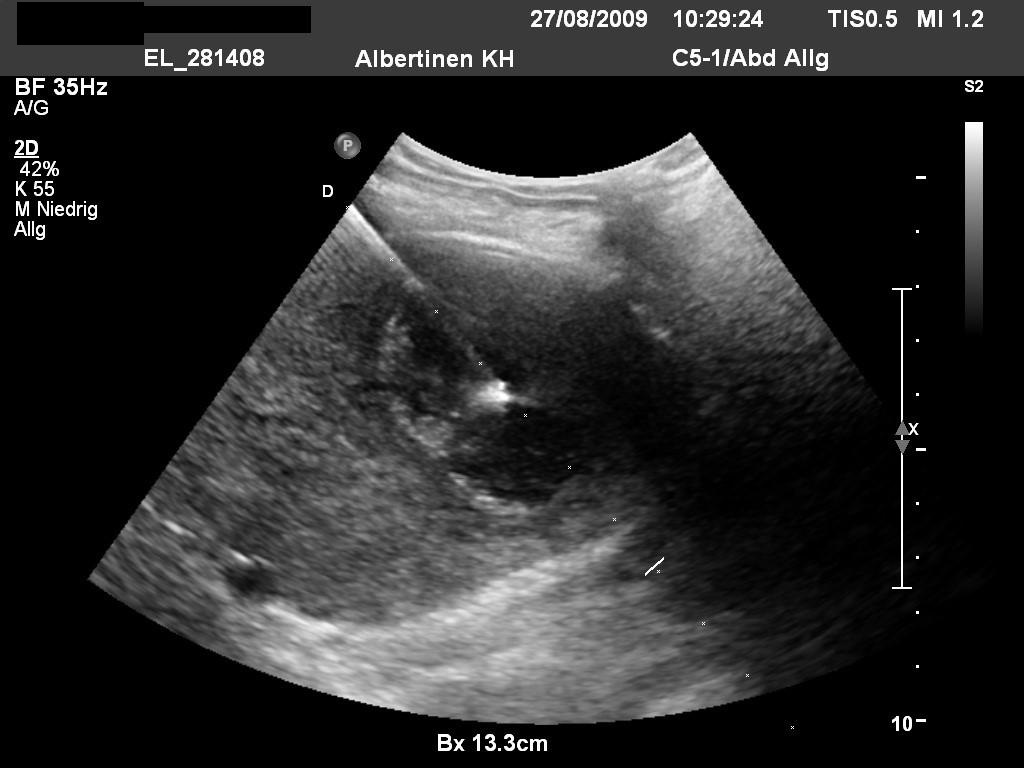
Sonografie: Leberabszess mit Anlage einer Abszessdrainage (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)
Quellen
Literatur
- Sharma S, Ahuja V. Liver abscess: Complications and Treatment. CLD 2021; 18: 122-126. doi:10.1002/cld.1128 DOI
- Lardiere-Deguelte S, Ragot E, Amroun K, et al. Hepatic abscess: Diagnosis and management. J Visc Surg 2015; 152: 231-243. doi:10.1016/j.jviscsurg.2015.01.013 DOI
- Peralta R. Liver Abscess. Medscape, updated March 27, 2020. Zugriff 02.04.22. emedicine.medscape.com
- Mavilia M, Molina M, Wu G. The Evolving Nature of Hepatic Abscess: A Review. J Clin Trans Hepatol 2016; 4: 158–168. www.ncbi.nlm.nih.gov
Autor*innen
- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.